Zur Theorie des Informationskapitalismus
Teil 2: Produktive und unproduktive Arbeit
Streifzüge 2/2003 von Stefan Meretz
(Dieser Beitrag reiht sich ein in den Versuch, Freie Software im Informationskapitalismus zu denken. Vorhergehende Streifzüge-Aufsätze in dieser Reihe sind: Christian Fuchs, Die IdiotInnen des Kapitals. „Freie“ Softwareproduktion – Antizipation des Postkapitalismus? (1/2001); Stefan Meretz, Produktivkraftentwicklung und Aufhebung (2/2001); Sabine Nuss, Michael Heinrich, Freie Software und Kapitalismus (1/2002); Ernst Lohoff, Die Ware im Zeitalter ihrer arbeitslosen Reproduzierbarkeit (3/2002). Dieser Beitrag kann online diskutiert werden unter www.opentheory.org/info_kap_1/text.phtml)
Im ersten Teil dieser kleinen Artikelserie (Meretz 2003) ging es um die „Keimform-Debatte“, also um die möglichen Wege gesellschaftlicher Transformation. Die These von der Freien Software als Keimform einer gesellschaftlichen Konstitution jenseits der Warenform basiert auf einer bestimmten Analyse des gegenwärtigen Entwicklungsstandes des so genannten „Informationskapitalismus“. Darum soll es in diesem Teil gehen, genauer: um die Diskussion zur un/produktiven Arbeit und zu aktuellen Angriffen im Informationskapitalismus.
Begriffliches
Leichthin wird vom Informationskapitalismus geredet – aber was ist das Spezifikum dieser Phase des Kapitalismus? Um sich dieser Frage zu nähern, ist es notwendig, die stoffliche Seite der Entwicklung des Kapitalismus zu untersuchen.1 Marx hat dies in seiner Zeit getan, ich kenne jedoch keine adäquate Weiterführung des Marxschen Ansatzes. Vermutlich hat das auch damit zu tun, dass ein wesentliches Moment der Entwicklung erst jetzt in aller Deutlichkeit hervortritt: das der „Information“, des „Wissens“ oder wie auch immer man den algorithmischen Aspekt industrieller Produktion bezeichnen mag. Aber beginnen wir mit dem Übergang zum Kapitalismus und damit mit Marx.
Im „Maschinerie-Kapitel“ des Kapital untersucht Marx (1890) die stoffliche Seite kapitalistischer Industrieproduktion. Er identifiziert drei Aspekte der „großen Maschinerie“:
- Werkzeugmaschine
- Bewegungsmaschine
- Transmissionsmechanismus
Nachfolgende Rezeptionen haben diese Systematisierung als nicht mehr zeitgemäß fallengelassen. Wie ich zeigen möchte, hat Marx jedoch im Gegensatz zu oberflächlichen Zurückweisungen eine adäquate Einteilung mit erstaunlicher Reichweite vorgenommen.
Werkzeug – Sachlogik
Die Werkzeugmaschine vergegenständlicht den sachlogischen Aspekt des auf eine Maschine übertragenen Werkzeugs des (Manufaktur-) Handwerkers. Hier wird nicht nur einfach das Werkzeug in eine Maschine „eingespannt“, sondern es wird so in die Maschine eingebracht, dass die Prozessanforderungen des jeweiligen Herstellungsschrittes sachgerecht erfüllt werden können. Anderenfalls würde das Werkzeug beschädigt, die angestrebte Produktqualität nicht erreicht werden etc.
Die Bewegungsmaschine liefert die zum Betrieb des Produktionsprozesses notwendige Energie – zu Marx‘ Zeiten war dies die unmittelbare Anlieferung von „Bewegung“. Allgemeiner formuliert handelt es sich hier um die Energiemaschine, die heute in räumlicher Trennung zum Produktionsprozess in der Regel elektrische Energie bereitstellt. Sie ist der bzgl. der Werkzeugmaschine nachgeordnete Faktor der industriellen Revolution. Marx ließ sich hier nicht durch die Schlote der Dampfmaschinen die Sinne vernebeln und stellte klar, dass es „die Werkzeugmaschine ist …, wovon die industrielle Revolution ausgeht“ (393), und die erst sekundär „die revolutionierte Dampfmaschine notwendig machte“ (396). Gleichwohl hält sich die umgekehrte Behauptung hartnäckig.
Das „Unding“: Transmission
Der dritte von Marx „Transmissionsmechanismus“ genannte Aspekt schließlich wird in der Regel vollends unter den Tisch fallen gelassen: So etwas gibt es doch gar nicht mehr! Das ist nur dann richtig, wenn man nach Lederriemen sucht, die in der Fabrikhalle unter der Decke laufen und Bewegungsenergie übertragen. Begreift man die Transmission jedoch als das, was sie neben der Energieübertragung auch ist – ein (vergegenständlichter) Algorithmus -, dann öffnen sich neue Erkenntnisperspektiven. Denn was beim Produktionsschritt vor allem übertragen wird, ist zeitlich bestimmte Prozesslogik: Die zu Marx‘ Zeiten genutzten Lederriemenbänder und Zahnräder bewirken eine wohldefinierte Kombination von prozessadäquaten Bewegungen. Erst deren zeitlogisch abgestimmtes Zueinander ergibt in Verbindung mit dem Werkzeug den antizipierten Herstellakt.
Algorithmus – Zeitlogik
Den algorithmischen Produktionsaspekt kann man erst „sehen“, wenn man einen Begriff vom Algorithmus hat, denn damals waren alle drei Aspekte „in“ einer Maschine gegenständlich vereint. Ein Algorithmus ist die ideelle Antizipation eines Prozesses (vgl. dazu ausführlich Meretz 1999).2 Algorithmen zu erschaffen, ist eine genuin menschliche Tätigkeit. Jede gedankliche Selbstdiskussion oder kollektive Entwicklung zeitlich bestimmter Abläufe lässt sich so als Schöpfung von Algorithmen fassen. Ein Algorithmus kann in unterschiedlichen Formen vergegenständlicht werden. Die bekannteste Form ist wohl die Schriftform. Beispiele sind das Kochbuch oder die Turing-Maschine (eine „Maschine“, die nur textuell „abläuft“).
Im Kontext dieses Aufsatzes interessiert uns die Vergegenständlichung in Maschinenform. Eine Maschine ist die stoffliche Form eines Algorithmus. Sie realisiert einen ideell antizipierten Prozess. Im Unterschied zum Werkzeug, das „alleine“ keinen Algorithmus verkörpert, geht es hier nicht um die Sachlogik, sondern um die Zeitlogik – eben um den Ablauf der Teilschritte beim Herstellakt. Sachlogik und Zeitlogik werden oft vermischt, und zu Marx‘ Zeiten waren beide Aspekte ja auch gegenständlich „in“ einer Maschine vereint und damit „unsichtbar“. Sie sind jedoch analytisch zu trennen.
Verallgemeinern wir unseren Blick weg von einem mechanischen Produktionsablauf, wie er Marx vor Augen hatte, hin zu einem allgemeinen Produktionsprozess stofflicher Güter, dann lassen sich die drei Marxschen Aspekte der großen Maschinerie reformulieren als
- Sachlogik (Werkzeugmaschine)
- Energiebereitstellung (Energiemaschine)
- Zeitlogik (Algorithmus)
Wie schon bemerkt, ist dabei die Energiebereitstellung ein sekundärer Faktor. Zur Aufschließung der innerkapitalistischen Entwicklungsetappen trägt er analytisch nichts bei. Er wurde bereits mit dem ersten Schritt in den Kapitalismus, dem Übergang von der Manufaktur zur Fabrik, „abgespalten“.
Mit dem neuen Begriffswerkzeug sind die innerkapitalistischen Entwicklungsetappen relativ leicht zu entschlüsseln (vgl. dazu die Abbildung). In der Durchsetzungsphase der warenproduzierenden Gesellschaft ist der/die Handwerker/in idealiter Träger aller drei „Aspekte“. So besteht der erste Schritt zunächst darin, ihn und sie in eine Manufaktur zu sperren, in der er und sie „arbeiten lernt“ (auf die Terrorgeschichte der Durchsetzung von „Arbeit“ kann hier nicht eingegangen werden).
Sachlogik-Revolution: Werkzeugübertragung
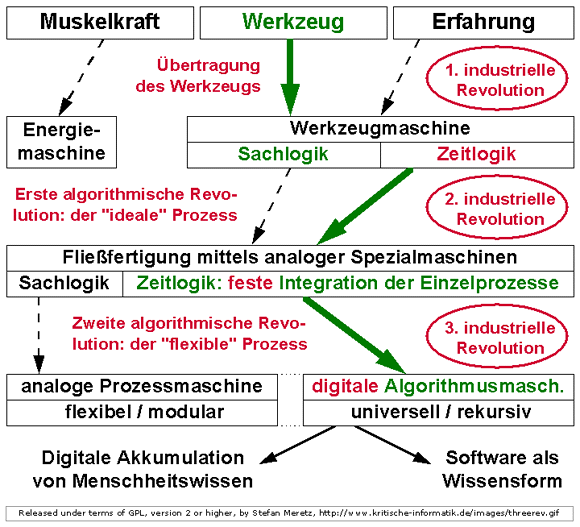
Das revolutionierende Moment der Ersten Industriellen Revolution besteht – wie Marx richtig bestimmte – in der Übertragung des Werkzeuges auf eine Maschine. Mit dieser Übertragung wurde gleichzeitig das algorithmische Prozesswissen des Handwerkers „in“ der Maschine vergegenständlicht und die Energielieferung ausgelagert. Durch diesen Prozess der Entsubjektivierung der Tätigkeiten des Handwerkers, durch die Formatierung von Lebenstätigkeiten zu „Arbeit“, wurden die nun getrennten drei Bestandteile des Produktionsprozesses der separaten wissenschaftlichen „Bearbeitung“ zugänglich. Neue „Wissenschaften“ entstanden, Normung, Reduzierung von Produkttoleranzen, Steigung der Gleichförmigkeit in der objektivierten Produktion usw. bedeuteten einen ungeheuren Schub bei der endgültigen Durchsetzung des Kapitalismus als „schöner Maschine“.
Zeitlogik-Revolution 1: Algorithmisierung der Produktion
Der nächste qualitative Sprung basiert auf einer Revolutionierung des algorithmischen Produktionsaspekts. So wie das Werkzeug so wurde auch der Produktionsprozess der „grellen Verhörlampe der Aufklärungsvernunft“ (Kurz 1999, 372) in Form der Taylorschen „Arbeitswissenschaft“ unterzogen. Die Zweite Industrielle Revolution ist gleichzeitig die erste algorithmische Revolution: Es ging um die von Ingenieuren vorgedachte und durchexerzierte algorithmische Integration der gesamten Produktion und damit gleichzeitig um die totale Unterordnung der Menschen unter die Erfordernisse der „Wertmaschine“. Der „ideale Prozess“ war das Leitbild, die Durchsetzung der abstrakten Zeit als Taktgeber das Mittel, die optimierte Zeitlogik in der Fließfertigung („Fließband“) analoger Spezialmaschinen das Resultat.
Zeitlogik-Revolution 2: Algorithmisierung der Algorithmisierung
Die stoffliche Verkopplung von Sachlogik und Zeitlogik ermöglichte zwar eine massenhafte Produktion uniformer Güter als Waren, machte jedoch die Produktion starr und unflexibel. Jede Änderung der Zeitlogik bedeutete immer auch eine Änderung der Sachlogik. Hier greift die zweite algorithmische Revolution, die auch als Dritte Industrielle Revolution bezeichnet wird. Sie bricht auf, was der Taylorismus aufwändig festgelegt hat: Die algorithmische Durchrationalisierung der Produktion. Nun wird nicht mehr der geplante Produktionsablauf exakt festgelegt und in Formen von Maschinen, starrer Arbeitsorganisation und Hierarchien „gegossen“, sondern es werden die Möglichkeit der Änderbarkeit des Ablaufes, die Mannigfaltigkeit der möglichen Einsätze der Werkzeugmaschinen, die Modularität der Einheiten in der Fließfertigung in die Produktion eingebaut. Die festen Algorithmen des Taylorismus werden flexibilisiert, wobei das Ausmaß der Änderbarkeit nicht unendlich ist, sondern wiederum festliegt. Wurde also vorher der Ablauf algorithmisiert, so nun die Änderbarkeit des Ablaufes – eine Algorithmisierung zweiter Ordnung.
Doppelte Universalmaschinen
Die zweite algorithmische Revolution ist eng verbunden mit der Trennung und Vergegenständlichung des sachlogischen und zeitlogischen Produktionsaspekts in zwei separaten Universalmaschinen: der Algorithmusmaschine „Computer“ und der flexibel steuerbaren Prozessmaschine. Der Grad der Universalität ist jedoch unterschiedlich. Sie hängt bei der analogen Prozessmaschine von der Antizipationsfähigkeit der Produzenten ab, denn es kann immer nur der Grad an Änderbarkeit und Modularität dargestellt werden, der aktuell als mögliche Prozessbreite vorstellbar ist. Genuin „Neues“ – seien es Erfindungen oder radikal neue Marktanforderungen – ist nicht vorhersehbar.
Bei der digitalen Algorithmusmaschine, dem Computer, ist es vor allem der Stand der (hard- und software-) technischen Entwicklung, der die Einsatzmöglichkeiten begrenzt, denn die digitale Form der formalen Algorithmen ist a priori universell. Mit der Schaffung von mehrfach gestaffelten „Programmen zur Erzeugung von Programmen“ kommt die grundlegende Kennzeichnung der Dritten industriellen Revolution als „Algorithmisierung der Algorithmisierung“ sinnlich erfahrbar auf ihren Begriff. Die Universalität der digitalen Form ist es, die zur Durchdringung nahezu aller Bereiche der gesellschaftlichen Re/Produktion führt (sekundäre Algorithmisierung bürokratischer, monetärer etc. Prozesse). Der Computer ist allgegenwärtig (ubiquitous computing), und die Entwicklung ist lange nicht am Ende.
Drei innere Schranken
Mit der Dritten Industriellen Revolution ist der Kapitalismus in dreifacher Hinsicht an innere Schranken gestoßen:
- Abschmelzen der Wertsubstanz
- Auszehren der Produktivkraftentwicklung
- Entknappung des Wissens
Das bestimmende Moment ist die Unmöglichkeit, das Abschmelzen der Wertsubstanz aufgrund von Produktivitätssteigerungen und Ausdehnung der kapitalunproduktiven Arbeit durch Ausweitung der Produktion (über-) zu kompensieren. Dieses bestimmende Moment wird jedoch durch die anderen beiden „Schranken“ beeinflusst. Hier kommt unsere Analyse der stofflichen Seite der kapitalistischen Entwicklung zum Tragen.
Auszehren der Produktivkraftentwicklung
Ein ökonomisch gesehen gegenläufiger Einfluss ist die Unfähigkeit des Kapitalismus, das gegebene Niveau der Produktivkraftentwicklung qualitativ zu überschreiten. Der Terminus „Dritte Industrielle Revolution“ suggeriert dieselbe bereits als „vollzogen“. Dem ist jedoch nicht so. Mit der zweiten zeitlogischen Revolution kam es zwar zur Entstehung der doppelten Universalmaschinen, und hierbei kommt sicherlich der digitalen Algorithmusmaschine „Computer“ eine entscheidende Bedeutung zu. Die Produktivkraftentwicklung verstanden als das Verhältnis von Mensch, Natur und Mittel3 hängt qualitativ jedoch gewissermaßen noch in der dem Taylorismus/Fordismus zuzurechnenden Epoche der „Mittelrevolution“. Solange der Arbeiter bloß Anhängsel der Maschine war (Zweite Industrielle Revolution), war es egal, was dieser dachte, fühlte und plante – am besten, er tat nichts dergleichen. Es ist jedoch eine Fiktion, zu meinen, dieses Mensch-Mittel-Verhältnis für die Algorithmisierung zweiter Ordnung fortschreiben zu können.4 Hier wird „eigentlich“ ein sich unbeschränkt entfaltender Mensch „gebraucht“, der keinem Fetisch folgt, sondern einzig seinen Bedürfnissen – Momente, wie sie in der Freien Software aufscheinen, aber niemals innerhalb der Verwertungslogik realisiert werden können.
So wird die irritierende Beobachtung gemacht, dass gerade der Computereinsatz nicht zur Steigerung der Produktivität geführt hat – diskutiert als so genanntes Produktivitätsparadoxon: „You can see the computer age everywhere, except in the productivity statistics“ (Solow 1987). Über die Gründe wurde und wird wild spekuliert, doch die Überlegung, dass eine universalisierte Produktion den universellen Menschen erfordert, liegt außerhalb der Denkmöglichkeiten. Mit dem zu Ende gehenden Fordismus wurden zwar die betrieblichen Hierarchien abgebaut, und sind größere Handlungsspielräume entstanden. Diese werden jedoch durch die unmittelbare Konfrontation der Arbeitenden mit dem Marktdruck wieder aufgehoben, gerade in Krisenzeiten. Der durch den Einzelnen hindurchgehende antagonistische Widerspruch ist der zwischen Selbstentfaltung und Selbstverwertung. Dem „Kommunismus der Sachen“5 steht das in der Verwertungszwangsjacke gefangene Warensubjekt erstarrt gegenüber.
Entknappung des Wissens
Das Verhältnis zwischen stoffumwandelndem Kernprozess und gesamtgesellschaftlicher informationell-algorithmischer Vernetzung und Steuerung verschiebt sich beständig zugunsten der informationellen Seite. Es ist absehbar, dass die Bedeutung des stoffumwandelnden Kernprozesses in Zukunft genauso zu einer Residualgröße zusammenschrumpft, wie die naturale Produktion in der kapitalistischen Industriegesellschaft. Mit der analogen Vergegenständlichung des handwerklichen Erfahrungswissens fing ein Prozess an, der heute bei der digitalen Akkumulation des Menschheitswissens angelangt ist. Die Herausbildung der digitalen Form macht das Wissen verlustfrei und mit geringem Aufwand kopierbar, sein „unverantwortlicher Hang zur Verunknappung“ (Lohoff 2002, 33) steht der Wertverwertung damit unmittelbar entgegen. Die global vernetzte Wissensproduktion und die proprietäre Warenform der Wissensnutzung – sei es als proprietäre Software, Bilder, Filme, Musik, Produktionspläne, chemische Formeln etc. – geraten in einen unauflösbaren Widerspruch zueinander. Es wäre jedoch kurzschlüssig, zu meinen, dass etwa „Raubkopien“ hier die Warenform ernsthaft beschädigen könnten.6
Wichtig für die weitere Diskussion ist, zu verstehen, dass „Wissen“ sich keinesfalls bloß auf das „Gold in den Köpfen“ bezieht, sondern vor allem auf die historische Kumulation vergegenständlichter Sach- und Zeitlogik, die sich mit der Dritten Industriellen Revolution vom materiellen Substrat löst und als digitales Menschheitswissen potenziell allen zur Verfügung steht. Die Wissensrevolution besteht also nicht nur darin, dass in den Wissenschaften mehr Papier bzw. Bytes oder in den TV-Stationen mehr Talkshows produziert werden, sondern darin, dass vorhandenes Menschheitswissen in die digitale Form gebracht wird. Von hier aus ist es nur ein kleiner Schritt, sozusagen im Medium des (digitalen) Wissens neues (digitales) Wissen zu generieren.
Obgleich wegen der Universalität der digitalen Form substanziell nicht aufweisbar, sind dennoch die beiden Wissensarten – ich will sie hier „Produktionswissen“ und „Konsumtionswissen“ nennen – analytisch zu unterscheiden. Produktionswissen, also das algorithmische Wissen im engeren Sinne, dient dazu, andere Prozesse zu beschreiben, zu steuern oder zu vermitteln und wird nicht „direkt“ konsumiert (Beispiel: Software). Konsumtionswissen hingegen treibt keine Folgeprozesse an, sondern wird von Menschen unmittelbar aufgenommen (Beispiel: Bilder, Filme). Natürlich gibt es auch hier Grenzfälle, bei denen beide Aspekte „zusammengeschlossen“ vorliegen (Beispiel: Spiele, Lernsoftware), doch sind stets auch hier Tendenzen zur Separierung der Bestandteile im Gange (etwa die Trennung von Engine und Storylines).
Aufbau oder Verzehr von Wertsubstanz7
Kern der Differenz zur politökonomischen Analyse von Ernst Lohoff ist die Frage, ob denn die „Informationsarbeit“ nun „Wertsubstanz“ aufbaut oder Abzug von ihr ist. Er vertritt den Standpunkt, dass Informationsarbeit universelle gesellschaftliche Arbeit sei und daher „aus dem wertproduktiven Sektor alimentiert“ werden müsse: „Grundsätzlich werttheoretisch betrachtet ist es für die gesellschaftliche Gesamtwertschöpfungsbilanz völlig irrelevant, wie der Informations- und Kommunikationsbereich organisiert ist, ob er von Einzelkapitalien nach betriebswirtschaftlichen Kriterien betrieben wird oder etwa dem Staat obliegt.“ Diese Betrachtung halte ich für verkürzt.
Wie ich in der historisch-analytischen Rekonstruktion versuchte zu zeigen, hat das Produktionswissen mit der Ablösung von seinem gegenständlichen Träger und der Digitalisierung keinesfalls seine Funktion im Produktionszusammenhang verloren. Die Rede von der Informations- oder Wissensarbeit – vielleicht noch verbunden mit dem Hinweis, dass es das ja „eigentlich schon immer“ gegeben habe – isoliert die jeweilige Tätigkeit aus seinem funktionalen Zusammenhang der gesellschaftlichen Gesamtarbeit. Es gibt keine Wissensarbeit „an sich“, es gibt sie nur in Bezug auf bestimmte ökonomische oder gesellschaftliche Prozesse.
Software
Eine Form von Produktionswissen kann Software sein. Um die Wissensform Software soll es im folgenden gehen. Der Software ist ob ihrer bloßen Gestaltung nicht anzusehen, ob sie in – werttheoretisch gemeint – produktive oder unproduktive Prozesse eingebunden ist. Diese Frage lässt sich ohnehin nicht einzelbetrieblich, sondern nur gesamtgesellschaftlich diskutieren. Informations- oder Wissensarbeit trägt zum Aufbau von Wertsubstanz bei – ist also produktive Arbeit – in dem Maße wie sie in produktive Produktionsprozesse eingebunden ist. Sie wird aus den wertproduktiven Sektoren der Gesellschaft alimentiert, sofern sie Bestandteil unproduktiver Prozesse ist. Das macht die Sache nicht einfacher, sondern viel komplizierter – wenn wir etwa an das Beispiel des Friseurs denken, der dann produktive Arbeit verrichtet, wenn er produktiven Arbeitern die Haare schneidet und sonst nicht (vgl. Kurz 1995, 35). Analog kann man sich etwa die individuelle Benutzung von Software am Heimarbeitsplatz vorstellen – ich komme darauf zurück.
Technischer und moralischer Verschleiß
Ein zentrales Argument, warum Software genuin „wertlos“ sein solle, ist die Tatsache, dass sie technisch nicht verschleißt. Folglich finde auch kein „Wertübertrag“ wie etwa bei Maschinen statt, die regelmäßig erneuert und gewartet werden müssen und irgendwann „abgenutzt“ sind. – Erneuerung und Wartung des algorithmischen Bestandteils des Produktionsprozesses, also der Software, ist jedoch genauso notwendig wie die Erhaltung der stofflichen Funktionsfähigkeit der produktiven Abläufe. Was bei Marx als Sonderfall behandelt wurde, nämlich der so genannte „moralische Verschleiß“, ist hier Hauptmoment: In einer sich ändernden Umgebung altert Software mit dem Prozess, den sie antreibt oder vermittelt. Eine Maschine kann ihre Wertübertragung nur in Relation zum gesellschaftlich durchschnittlichen Produktivitätsniveau leisten. Mit allgemeiner Verkürzung der jeweils durchschnittlich notwendigen gesellschaftlichen Arbeit nimmt die Wertübertragung der Maschine wie auch der mit ihr verbundenen Software ab.
Ökonomisch ist technischer Verschleiß also Wertübertragung, während moralischer Verschleiß eine Entwertung darstellt. Software kann nur moralisch, nicht aber technisch verschleißen. Software, eingebunden in produktive, also Wertsubstanz aufbauende Prozesse, überträgt wie der vermittelte stoffliche Prozess selbst ihren Wert während der Lebensdauer dieses Prozesses.8 Sofern die Software als Programmierdienstleistung individuell für den produktiven Prozess angefertigt wurde, ist dies noch relativ einsichtig, denn hier gibt es keinen Unterschied zur „analogen“ Maschine des Fordismus, in der Werkzeug- und Algorithmusmaschine noch stofflich zusammengeschlossen waren: „In einem solchen Kontext ist sie [die Software] genauso wertproduktiv wie die Herstellung von Maschinen.“ (Lohoff 2002, 32)9
Massen-Software
Komplizierter ist der Fall von Software, die nicht bloß als Individualsoftware hergestellt, sondern massenhaft redupliziert wird. Lohoff: „Für ein millionenfach anwendbares universelles Programm, das beliebig unter vernachlässigbarer weiterer Arbeitsverausgabung reproduziert werden kann, gilt das (ihre Wertproduktivität) aber eben nicht mehr.“ Warum nicht? Welchen Wert hat hier das einzelne Softwareexemplar? Während die bürgerliche Wissenschaft diesen Fall nur als „digitales Dilemma“ (Hofmann 2000) abbilden kann – das Original ist „teuer“, die Kopien nahezu „kostenlos“ – können wir diesen Fall mit der hier entwickelten Argumentation als Verteilung der Wertübertragung auf alle in wertproduktiven Kontexten eingesetzte Exemplare der Software während ihrer „Lebenszeit“ begreifen. Werden die Softwareexemplare nur zu einem Teil in wertproduktiven Prozessen eingesetzt, dann wird auch nur dieser Anteil als Wert übertragen, während der andere Anteil gesamtgesellschaftlich aus anderer Wertschöpfung alimentiert werden muss. Verkürzt sich die „Lebenszeit“ über das durchschnittliche Maß hinaus – als „vorzeitiger moralischer Verschleiß“ etwa durch Auftreten eines besseren Konkurrenzproduktes -, dann trägt auch das zur Reduktion der Wertübertragung bei.
Die gleiche Unterscheidung ist auch für die Reproduktion der Ware Arbeitskraft bei der individuellen Vernutzung von Software zu treffen. Ist etwa die Anwendung der Tabellenkalkulation Bestandteil der Haushaltsführung und somit der Reproduktionskosten des produktiven Arbeiters, so schlägt der Anteil dieser Softwareexemplare gesamtgesellschaftlich für die Wertsubstanz positiv zu Buche, während die gleiche Nutzung durch einen unproduktiven Arbeiter im entsprechenden Anteil alimentiert werden muss. Analytisch kann man diese Differenzierung noch weiter treiben und produktiven von unproduktiven Konsum bei ein und demselben Softwareexemplar unterscheiden.10
Ernst Lohoff geht somit fehl, jede Softwareproduktion mit dem Begriff der „arbeitslosen Reproduktion“ zu fassen. Man kann der jeweiligen Tätigkeit des Softwareentwicklers nicht ansehen, ob es sich dabei um wertproduktive Arbeit oder um wertverzehrende unproduktive Arbeit handelt. Diese Erkenntnis ist nicht durch bloße Anschauung, sondern nur analytisch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene bestimmbar. Software wie andere Wissensformen kann man verallgemeinernd ökonomisch als „geronnene Dienstleistungen“ betrachten. So wie generell bei Dienstleistungen ist es nicht die Nichtstofflichkeit, die ihren ökonomischen Charakter bestimmt, sondern ihre Funktion im Verwertungsprozess – wie oben dargelegt. Was bei den unmittelbaren Dienstleistungen schon analytisch schwer zu bestimmen ist, wird bei „gespeicherter Dienstleistung“, Software, noch einmal besonders schwierig. Hier dürfen wir jedoch analytisch genauso wenig den Fehler machen, auf die Ebene einer „kruden Materialität“ zurückzufallen wie bei den unmittelbaren Dienstleistungen.
Raubkopien und Freie Software
Nach der vorgelegten Analyse wirkt sich jede „Raubkopie“ in der Gesamtwertschöpfungsbilanz unterschiedlich aus: Wird die Kopie in wertproduktiver Produktion oder für die Reproduktion eines produktiven Arbeiters verwendet, so schmälert sie proportional den Anteil der Wertübertragung bzw. Wertrealisierung um diese „Zusatzkopie“. Die „raubkopierte“ Software, die in unproduktiven Umständen Verwendung findet, hat hingegen keine Auswirkung auf die gesamtgesellschaftliche Wertschöpfungsbilanz. Sie bedeutet jedoch in Bezug auf das „betroffene“ Einzelkapital eine monetäre Einnahmeschmälerung bzw. im Fall von Monopolisten (wie Microsoft) eine Minderung der „Informationsrente“ – wie sie Ernst Lohoff (2002) entwickelte.
Freie Software unterscheidet sich ökonomisch von Raubkopien fundamental. Freie Software ist – unabhängig davon, ob Freie Software „kommerziell“, also gegen Bezahlung, oder „just for fun“ hergestellt wird – „wert(substanz)los“. Ihre Herstellung muss also aus wertproduktiven Sektoren alimentiert werden, entweder direkt durch Bezahlung der Herstellung per Auftrag oder indirekt per Alimentierung der Hacker. Sie ist aber noch in einem zweiten, viel wichtigeren Sinne „wertlos“. Ersetzt sie proprietäre Software, so entwertet sie die damit verbundenen Prozesse. Das kann für das Einzelkapital nützlich sein und einen kurzfristigen Konkurrenzvorteil bringen, bedeutet aber gesellschaftlich eine zunehmende „Auskoppelung“ bislang wertproduktiver Sektoren.
Freie Software sorgt also nicht nur für eine weitere Minderung der Wertsubstanz, sie bedeutet auch aktive Entknappung des Wissens und ist gleichzeitig Keimform einer neuen Form der Produktivkraftentwicklung, in deren Zentrum der individuelle Mensch steht (vgl. Meretz 2003). Freie Software beschleunigt damit nicht nur den Prozess, der sowieso abläuft, sondern sie bildet gleichzeitig die Möglichkeit, jenseits der Wertform neue Produktions- und Verkehrsformen aufzubauen.
Die unsichtbare Front wahrnehmen: Zu aktuellen Angriffen
Vor dem dargelegten Hintergrund wird deutlich, warum die entscheidenden Schlachten an einer nahezu unsichtbaren Front geschlagen werden: der Immaterialgüter-Rechte. Die Durchsetzung der Wertform in der warenproduzierenden Gesellschaft ist verbunden mit der Durchsetzung der Rechtsform als universellem abstraktem Prinzip. Ein entscheidender Aspekt war (und ist) ist die Verfügung über die Produktionsmittel, deren praktische wie rechtliche Garantie die Trennung in Verfüger und Verfügte schuf. Der Vorschlag des Traditionsmarxismus lief stets nur auf einen „Rollentausch“ hinaus, während der „Wert“ als übergreifendes Formprinzip nicht angetastet wurde – und mit ihm im übrigen auch nicht die Rechtsform, unabhängig von ihrer jeweiligen inhaltlichen Ausgestaltung. Im Sandkasten der Wertform ließ sich gut Reform und Revolution spielen ohne den Sandkasten zu verlassen.
Das ist nun vorbei. Der „Hang zur Verunknappung“ – „information wants to be free“ – stellt praktisch Wert- wie Rechtsform in Frage. Ist der stoffliche Reichtum ob seiner Gegenständlichkeit kontrollier- und verknappbar, so entzieht sich der digitale Reichtum dieser universalen Zurichtung: Die Warenform des Wissens kann nur mehr mit Polizeigewalt aufrechterhalten werden. Die Kontrolle soll individualisiert (Stichwort DRM: Digitales Rechte-Management) und die Universalität des Computers beendet werden (Stichwort TCPA: spezielle Hardware ermöglicht effektive Kontrolle).
Zugleich sollen alte Rechtsinstitute aufgerüstet werden: Das Patentrecht und das Urheberrecht. Beide zielen darauf ab, dem Erfinder bzw. Urheber ein befristetes Monopolnutzungs-, das heißt: Verwertungsrecht zuzuschreiben. Bezogen sich Patente bisher in Europa explizit nicht auf Software, so wurde die Verwertungs- und Knappheitslogik des Urheberrechts subversiv und effektiv durch Copyleft-Lizenzen11 unterlaufen. Hier läuft der doppelte Angriff: Algorithmisches Wissen soll patentierfähig werden, und das verschärfte Urheberrecht soll alle Schlupflöcher (Kopiererlaubnis für Wissenschaft und Bildung, Privatkopie12) der Nicht-Verwertung schließen. Diese Angriffe gehen einher mit der Vermarktlichung bisher staatlicher Leistungen im Rahmen internationaler Vereinbarungen (GATS), Internationalisierung des Copyrights (WIPO) und Angleichung des „Schutzes des geistigen Eigentums“ (TRIPS).
Ökonomisch bedeuten diese Änderungen zweierlei: Erstens werden den großen Verwertern Extra-Profite bzw. Informationsrenten zugeschanzt; zweitens werden unproduktive Staatsausgaben durch die Kassen privater Verwerter geschleust. Beides sind Indikatoren, dass die Substanz wertproduktiver Produktion schwindet und sich der Kampf um den globalen Topf der Revenuen verschärft: Die so genannte „Rechteindustrie“ wuchs in den letzten 20 Jahren doppelt so schnell wie der Rest der Wirtschaft.
Kritik und Aufhebung
In den zweiteiligen Überlegungen zum Informationskapitalismus wollte ich auf die extreme Widersprüchlichkeit der Situation aufmerksam machen. Einerseits die Herausbildung von Keimformen freier Vergesellschaftung auf Grundlage einer reichen Individualität und globalen Reichtumsgesellschaft; andererseits eine Aufrüstung der Fanatiker der Werts, um das Zerfallen der Wertform noch aufzuhalten. Wir sollten uns hüten, diese Widersprüchlichkeit in die eine oder andere Richtung zu vereinseitigen. Wir müssen sie analysieren, um sie zu verstehen, um sie zu kritisieren, um sie aufzuheben.
Denn hier läuft ab, was Marx in den Grundrissen bloß erahnte: Es ist „weder die unmittelbare Arbeit, die der Mensch selbst verrichtet, noch die Zeit, die er arbeitet, sondern die Aneignung seiner allgemeinen Produktivkraft, sein Verständnis der Natur und die Beherrschung derselben durch sein Dasein als Gesellschaftskörper – in einem Wort die Entwicklung des gesellschaftlichen Individuums, die als der große Grundpfeiler der Produktion und des Reichtums erscheint. (… ) Sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört und muss aufhören, die Arbeitszeit sein Maß zu sein und daher der Tauschwert [das Maß] des Gebrauchswerts. (… ) Damit bricht die auf dem Tauschwert ruhnde Produktion zusammen…“ (Marx 1857, 593)
Reichtum aneignen, Wertform aufheben
Der stoffliche und digitale Reichtum ist immens und wächst weiter, während sich der aus Wertsubstanz und damit produktiver Arbeit speisende „monetäre Reichtum“ verdünnt. Hier erleben wir den Übergang von „echter“ Wertschöpfung zur Umverteilung von Revenuen – nichts anderes bedeutet die Privatisierung staatlicher Aufgaben der Daseinsvorsorge.
Bei den Immaterialgütern erleben wir das Aufeinanderprallen zweier Reichtumsbegriffe besonders deutlich. Die auf Verwertung orientierte monetäre Reichtumsvorstellung kann sich immer weniger auf gelingende „reale“ Wertproduktion stützen, sondern zielt zunehmend auf die Umverteilung vorhandener Revenuen in Form von Informationsrenten oder Umleitung von Staatskonsum. Eine Aufrüstung der Rechtsform die notwendige Folge. Das „Recht des Stärkeren“ steht dabei nicht im Gegensatz zur „Stärke des Rechts“, sondern ist sein Ausdruck.
Parallel dazu entwickelt sich ein auf allgemeinen Nutzen orientierter „materialer Reichtumsbegriff“ – entweder als Notwehr oder aus der Erkenntnis, dass geteiltes Wissen vermehrten Nutzen für alle bedeutet.13 Die Freie Software ist hier nur ein Beispiel, das allerdings herausragt, weil sie auf den Kern der Produktivkraftentwicklung zielt. Eine Basisidee verbindet alle freien Ansätze: Aufbau von materialem (also auch digitalem) Reichtum, der für alle nutzbar ist. Das gelingt im Bereich der Immaterialgüter naturgemäß wesentlich einfacher, obwohl individuell auch hier stets die Frage steht: Könnte mir die Verknappung meines Beitrages eine nennenswerte monetäre Einnahme verschaffen oder vermehre ich den allgemeinen und damit auch meinen Nutzen jenseits der Geldform? Im Bereich der Immaterialgüter ist die Verbin- dung von Allgemeinnutzen und je meinem Nutzen wesentlich häufiger gegeben als im Bereich der stofflichen Güter. Hier wäre noch wesentlich intensiver über transmonetäre Vernetzungen nachzudenken, um diese Verbindung herzustellen.
Anmerkungen
1 Die „stoffliche Seite“ (inner-) kapitalistischer Entwicklung ist nicht zu verwechseln mit der „dinglichen Seite“ der geschaffenen Artefakte. Es geht also nicht darum, „was“ produziert wird, sondern „wie“. Eine Periodisierung der kapitalistischen Entwicklung über die „dingliche Seite“ der Erscheinungen („Kohle und Dampfkraft“, „Verbrennungsmotor“, „Fließband und … , Arbeitswissenschaft'“, „Elektronik und … , Informationswissenschaften'“) wie sie etwa Robert Kurz im „Schwarzbuch“ (2000) vorschlägt, verkennt die wesentlichen Momente und damit auch die wesentlichen innerkapitalistischen Transformationen. Der verdinglichten Sicht der Entwicklung entspricht ein ebensolcher verdinglichter Begriff der Produktivkraftentwicklung, wie ich ihn in Teil 1 dieses Aufsatzes kritisierte.
2 Dieser Algorithmusbegriff unterscheidet sich stark von dem der Informatik, der ausschließlich eine formale Beschreibung eindeutiger Syntax-Semantik-Relationen (Zeichen-Bedeutungs-Beziehungen) zulässt. Die informale Lebenswelt ist damit a priori ausgeschlossen, was die Informatik nicht davon abhält, die informale Welt in formale Beschreibungen zu pressen, die sie dann „Algorithmen“ nennt.
3 Vgl. zum Verständnis Meretz/Schlemm (2000). Dem wie auch immer „linken“ Alltagsverstand ist es nur schwer zugänglich, dass Produktivkraftentwicklung nicht mit Produktivitätsentwicklung gleichzusetzen ist, sondern neben den quantitativen (Output/Zeit) auch qualitative Momente (Art des Mensch-Natur-Mittel- Verhältnisses) besitzt, die u. U. nicht mit den Begriffen warengesellschaftlicher Rationalität fassbar sind.
4 Solche Versuche als „menschenleere Fabrik“ oder „computer integrated manufacturing“ (CIM) sind längst Geschichte: Der Weg ist gepflastert mit entsprechenden Havarien, und so wird es auch weitergehen (vgl. die Auseinandersetzung um Havarien in der computerbasierten Produktion, Meretz 2002).
5 Hierbei geht es nicht darum, die konkreten Erscheinungsformen der Waren zu überhöhen, sondern darum, auf die Potenzen des materialen Reichtums für einen Verein freier Menschen hinzuweisen.
6 Gleichwohl gilt es, die „Raubkopie“ zu enttabuisieren: „Raubkopie“ ist zivilgesellschaftliche Selbstverteidigung.
7 Für den folgenden Abschnitt setze ich die Kenntnis der wertkritischen Debatte um produktive und unproduktive Arbeit voraus und verweise auf Kurz (1995) und Mausebär (2002). Zur Definition ein Zitat: „Kreislauftheoretisch ist nur diejenige Arbeit kapitalproduktiv, deren Produkte (und damit ihre Reproduktionskosten) in den Akkumulationsprozess des Kapitals zurückkehren, d. h. deren Konsumtion wieder in die erweiterte Reproduktion eingespeist wird. Nur diese Konsumtion ist nicht bloß unmittelbar, sondern auch reproduktiv vermittelt eine , produktive Konsumtion'“ (Kurz 1995, 34).
8 Entsprechend muss Software eingebaut in Wertsubstanz verzehrende Prozesse mit diesen aus Wertproduktion alimentiert werden – etwa im Staatsapparat, Finanzwesen etc.
9 Nur am Rande sei darauf hingewiesen, dass die Fixierung auf die „geronnene Form“ intellektueller Dienstleistung, die Software, leicht die intellektuelle Dienstleistung in Form unmittelbarer menschlicher Tätigkeit als Beratung, Management, Konfiguration, Wartung usw. ausblendet. Keine Software kommt ohne diese Tätigkeiten aus, „nackte Software“ ist tot.
10 Krisentheoretisch betrachtet bedeutet dies, dass nicht nur immer mehr Arbeiter als „Arbeitslose“ unmittelbar monetär staatlich alimentiert werden müssen, sondern dass deren Konsum als unproduktive Verausgabung „herausfällt“ und keinen Beitrag zur erweiterten Reproduktion des Gesamtkapitals leistet. Die „Geld-istgenug- da“-Forderungen der „Umverteilung von oben nach unten“ würden also bestenfalls als Krisenaufschub wirken in einer Bewegung der stetigen Ausweitung der zu alimentierenden unproduktiven Sektoren der Gesellschaft.
11 Die Monopolverfügung des Urhebers – gedacht zur Verwertung – wird dazu verwendet, die Verknappung auszuschließen und die allgemeine Verfügbarkeit sicherzustellen.
12 Wo „Privatkopie“ verboten, ist „Raubkopie“ Pflicht!
13 So haben Wissenschaftler/innen freie Archive für wissenschaftliche Publikationen aufgebaut, um sich der Verknappungslogik und Monopolsituation großer Verlage zu entziehen (z. B. www. plos. org, www.doaj.org). Bekannt ist www.creativecommons. org mit dem Ziel der Freistellung von Immaterialgütern auf Basis der beschriebenen Copyright-Subversion. Interessant ist auch www.researchdisclosure. com, eine Datenbank zur Verhinderung von Patentierungen durch Veröffentlichung von Erfindungen.
Literatur
Hofmann, J. (2000), Das „digitale Dilemma“ und der Schutz des geistigen Eigentums, online: www.bildung2010.de/literatur/hofmann.pdf
Kurz, R. (1995), Die Himmelfahrt des Geldes, in: Krisis 16/17, 21-76.
Lohoff, E. (2002), Die Ware im Zeitalter ihrer arbeitslosen Reproduzierbarkeit, in: Streifzüge 3/2002, 29-36, online: www.giga.or.at/others/ krisis/e-lohoff_politischeoekonomie-information.html
Marx, K. (1857), Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Berlin (DDR): Dietz.
Marx, K. (1890), Das Kapital, Bd. 1, 4. Aufl. , in: Marx, Karl & Engels, Friedrich, Werke, Band 23, Berlin (DDR): Dietz, online: www.mlwerke.de/me/me23/
Mausebär (2002), Produktive Arbeit und Krise – Krise und Zusammenbruch bei Karl Marx und der Gruppe „Krisis“, in: CEE IEH 86, online: www.nadir.org/nadir/initiativ/ci/nf/86 /29.html
Meretz, S. (1999), Die doppelte algorithmische Revolution des Kapitalismus – oder: Von der Anarchie des Marktes zur selbstgeplanten Wirtschaft, online: www.kritische-informatik.de/?algorevl.htm
Meretz, S. (2002), Havarien als Normalität – Havarien der Theorie, online: www.opentheory.org/havarien_der_theorie/text.ph tml
Meretz, S. (2003), Zur Theorie des Informationskapitalismus, Teil 1: Von der negatorischen Haltung zur Theorie der Aufhebung, in: Streifzüge 1/2003, 31-37, online: www.opentheory.org/info_kap_1/ text.phtml
Meretz, S. , Schlemm, A. (2000), Subjektivität, Selbstentfaltung und Selbstorganisation, online: www.kritischeinformatik.de/? selbstl.htm
Solow, R. M. (1987), Review of , Manufacturing Matters‘, New York Times Book Review, 12.7.87, 36.